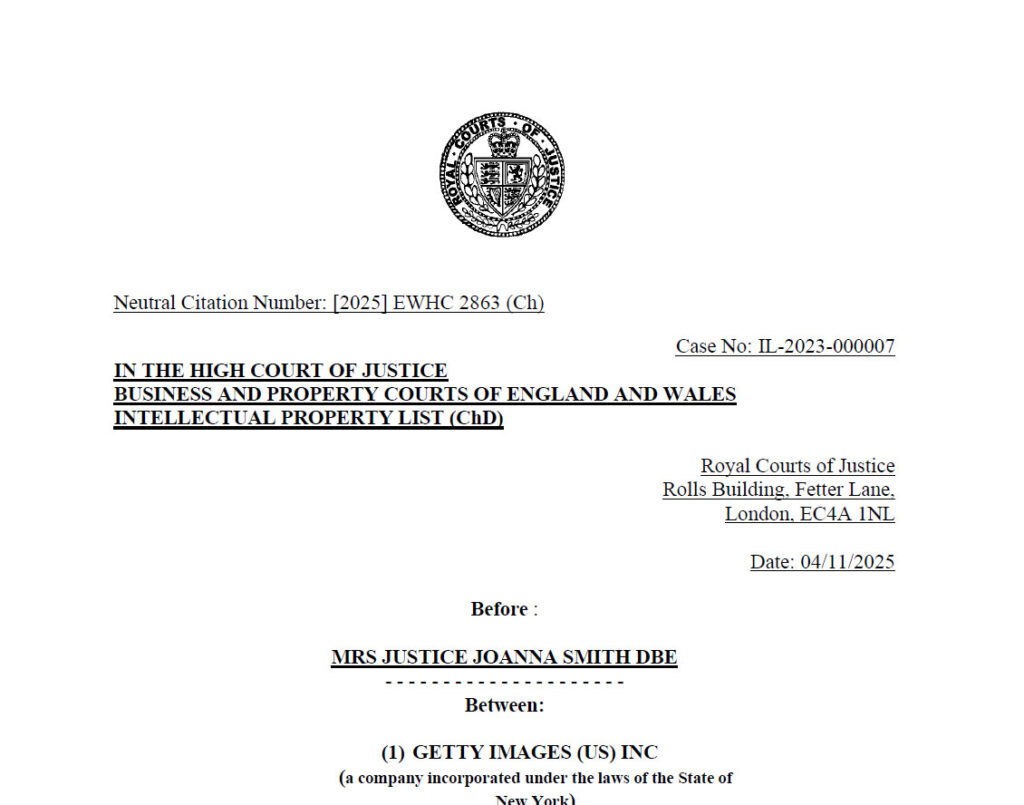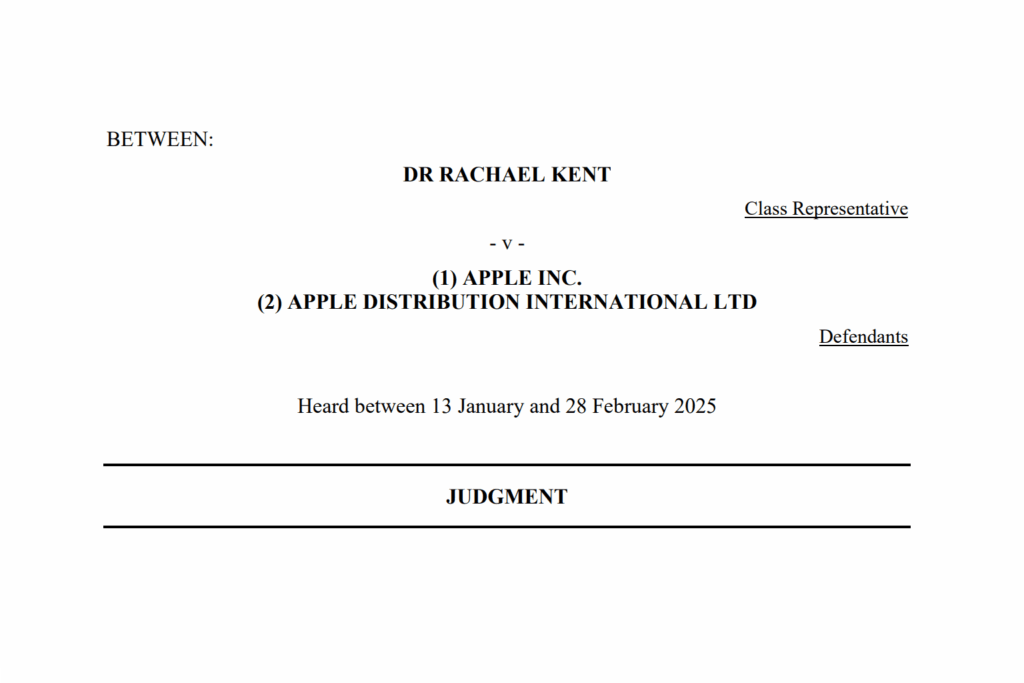Rechtskonformität ist eher selten die Lieblingsüberschrift in der Startup-Welt, doch für Venture-Capital-Investoren (VCs) und wachstumsstarke Gründer kann sie den Unterschied zwischen Hyperwachstum und teuren Rückschlägen ausmachen.
Für außereuropäische Venture-Capital-Firmen, insbesondere solche mit Sitz in den USA, Großbritannien oder Asien, ist das Verständnis und die Priorisierung der EU-Compliance entscheidend beim Investieren in europäische Start-ups oder beim Unterstützen von Portfoliounternehmen mit Expansionsplänen in den EU-Markt. Aufgrund des extraterritorialen Anwendungsbereichs von Gesetzen wie der DSGVO, dem DSA und der KI-Verordnung können auch Nicht-EU-Investoren direkt von Compliance-Verstößen europäischer Tochtergesellschaften oder Partner betroffen sein. Eine frühzeitige Ausrichtung an EU-Vorgaben schützt nicht nur vor regulatorischen Risiken bei grenzüberschreitenden Investitionen, sondern ermöglicht auch eine reibungslosere Skalierung, strategische Partnerschaften und wertsteigernde Exits im zweitgrößten digitalen Binnenmarkt der Welt.
Die Strafen bei Verstößen können leider erheblich sein. Metas „beispiellose“ DSGVO-Strafe in Höhe von €1,2 Milliarden im Jahr 2023 verdeutlicht die Tragweite. Doch auch kleinere Unternehmen sind nicht verschont: Das französische Startup Kaspr wurde von der CNIL mit €200.000 wegen der rechtswidrigen Sammlung von LinkedIn-Kontakten belegt. Wer EU-Recht ignoriert, riskiert Bußgelder, einstweilige Verfügungen und Reputationsschäden was Wachstum und Unternehmenswert negativ beeinträchtigt.
Im Gegensatz dazu schafft eine proaktive Compliance-Strategie Vertrauen bei Kunden, erleichtert die Expansion über Grenzen hinweg und kann Investoren anziehen, die Compliance als Zeichen von Professionalität sehen.
Einige Aspekte, die beachtet werden sollten:
1. DSGVO-Verstöße vermeiden
Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der EU gilt für alle Unternehmen, die personenbezogene Daten von EU-Bürgern verarbeiten – unabhängig von deren Größe. Verstöße können zu hohen Geldstrafen (bis zu 4 % des weltweiten Jahresumsatzes) und Klagen betroffener Personen führen.
Prominente Fälle zeigen die Risiken: 2024 verhängte die niederländische Datenschutzbehörde gegen Uber ein Bußgeld von €290 Millionen , weil Daten von EU-Fahrern unrechtmäßig in die USA übertragen wurden.
Startups und Scale-ups, insbesondere in den Bereichen Tech, Adtech, Fintech oder Gesundheit , müssen Datenschutz durch „Privacy by Design“ von Anfang an in ihre Produkte und Abläufe integrieren. Wichtige Compliance-Maßnahmen sind u.a. klare Einwilligung der Nutzer einzuholen, ggf. Datenschutzbeauftragte ernennen, Datenflüsse dokumentieren, Nutzerrechte wie Auskunft, Löschung oder Datenübertragbarkeit gewährleisten. Versäumnisse führen zu Datenschutzverletzungen, Bußgeldern, Vertrauensverlust und gefährden die VC-Unterstützung.
Beispiele für häufige Fehler:
-
Fehlende Datenschutzhinweise: Transparenz ist ein Grundprinzip. Unternehmen werden oft dafür bestraft, dass sie nicht in klarer Sprache mitteilen, wie Daten verwendet werden (wie im Fall Kaspr).
-
Keine rechtliche Grundlage: Häufig fehlt ein gültiger Zweck für die Datenverarbeitung (z. B. unzulässige Marketing-E-Mails).
-
Mangelhafte Sicherheit oder Löschpraxis: Werden Daten nicht gelöscht, wenn der Zweck entfällt, drohen Strafen. Die DSGVO verlangt Aktualität und Zweckbindung.
Folgen für VCs und Startups: Investoren sollten Datenschutzpraktiken gründlich prüfen. DSGVO-Verstöße (wie bei Uber und Meta) schädigen nicht nur finanziell, sondern auch das Vertrauen, was Bewertungen senken oder Deals gefährden kann.
DSGVO-konforme Startups können sich im Gegenteil als vertrauenswürdig positionieren und rechtliche Risiken vermeiden, die Investoren und Kunden abschrecken könnten.
2. Wettbewerbsrecht – Fair gewinnen
Das EU-Wettbewerbsrecht verbietet Preisabsprachen, Marktaufteilungen, Angebotsabsprachen und andere Formen der Kollusion sowie den Missbrauch marktbeherrschender Stellungen. Auch Fusionen und Übernahmen werden reguliert.
Ein neuer Fokus liegt auf sogenannten „No-Poach“-Absprachen und dem Austausch sensibler Informationen. Im Juni 2025 verhängte die EU-Kommission ein Bußgeld in Höhe von €329 Millionen gegen Delivery Hero und Glovo wegen eines Arbeitsmarkt-Kartells. Die Unternehmen hatten sich darauf geeinigt, keine Mitarbeiter gegenseitig abzuwerben, ein rechtswidriger Vorgang, so die Kommission. Es war die erste EU-Strafe für ein „Arbeitskartell“ mit Signalwirkung.
Häufige Wettbewerbsfehler bei Startups und VC-Deals:
-
No-Poach-Klauseln: Investoren schließen oft Abwerbeverbote in Beteiligungs- oder Arbeitsverträgen ein. Wie der Fall Delivery Hero/Glovo zeigt, kann selbst ein begrenztes Abwerbeverbot als wettbewerbswidrig gelten.
-
Marktaufteilung: Investitionen, die mit Gebietsschutz oder Exklusivitätsvereinbarungen einhergehen, können kartellrechtlich bedenklich sein.
-
Informationsaustausch: Startups mit demselben Investor dürfen keine wettbewerbsrelevanten Informationen austauschen (z. B. Preise, Produktpläne).
-
Fusionskontrolle: Auch wenn EU-Schwellen hoch sind, kann bei grenzüberschreitenden Deals eine Genehmigung erforderlich sein. Nicht gemeldete Übernahmen können rückgängig gemacht oder sanktioniert werden.
Folgen für VCs und Startups: Kartellstrafen (wie bei Delivery Hero/Glovo) können lähmend sein. Ermittlungen verzögern zudem Finanzierungsrunden oder Exits (IPO/M&A) um Jahre.
3. Geldwäscheprävention (AML) – Vertrauen im Finanzbereich schaffen
Anti-Geldwäsche-Gesetze (AML) verpflichten Unternehmen – insbesondere in Fintech, Krypto, Bankwesen oder Immobilien –, Kunden zu identifizieren (KYC), Transaktionen zu überwachen und verdächtige Aktivitäten zu melden. Der neue EU-AML-Rahmen (inkl. AMLA-Behörde) soll grenzüberschreitend einheitliche Regeln schaffen.
Strafmaßnahmen nehmen zu: Im April 2025 wurde Revolut von der litauischen Zentralbank mit €3,5 Millionen wegen Mängeln in der Geldwäschebekämpfung belegt – u. a. wegen unzureichender Überwachung von Transaktionen.
Typische AML-Versäumnisse bei Startups:
-
Schwache KYC-Prüfung: Unzureichende Identitätsprüfung bei Neukunden ist ein häufiger Fehler.
-
Fehlende Transaktionsüberwachung: Verdächtige Bewegungen nicht zu melden, zieht Strafen nach sich (wie im Fall Revolut).
-
Umgang mit politisch exponierten Personen (PEPs): Fehlende Sorgfalt bei PEPs oder sanktionierten Personen ist ein Compliance-Risiko.
-
Sanktionsverstöße: Geschäfte mit sanktionierten Partnern (auch versehentlich) können zu erheblichen Strafen führen.
Folgen für VCs und Startups: AML-Verstöße gefährden nicht nur Lizenzen, sondern auch das Vertrauen von Banken, Partnern und Investoren. Frühzeitiger Aufbau von AML-Compliance schafft Wettbewerbsvorteile und wirkt in der Due Diligence als positives Signal.
VCs sollten kartellrechtliche Due Diligence betreiben und auf Wettbewerbsbeschränkungen in Verträgen verzichten. Wer sich als fairer Marktteilnehmer positioniert, gewinnt nicht nur Kundenvertrauen, sondern punktet auch bei Regulierungsbehörden.
4. Digital Services Act (DSA) – Regeln für Online-Plattformen
Der EU-Digital Services Act (DSA) bringt weitreichende Pflichten für große Online-Plattformen und Suchmaschinen. Besonders betroffen sind sogenannte VLOPs (Very Large Online Platforms) mit über 45 Millionen EU-Nutzern. Anforderungen umfassen die Bekämpfung illegaler Inhalte, Transparenzberichte, Beschwerdemechanismen undSystemische Risikobewertungen.
Die Durchsetzung nimmt Fahrt auf: Die Kommission forderte 2024 Plattformen wie X (ehemals Twitter) zur Herausgabe von Informationen über illegale Inhalte und Desinformation auf.
DSA-Strafen können bis zu 6 % des weltweiten Umsatzes betragen – ähnlich wie bei der DSGVO.
Auch Startups müssen wachsam sein: Social-Apps, Marktplätze oder Werbedienste könnten schnell in den Anwendungsbereich geraten. Wichtige Punkte:
-
Schnelle Entfernung illegaler Inhalte: z. B. Hassrede, Betrug, Terrorismus.
-
Transparenzberichte: z. B. zu Moderation und Werbedaten.
-
Risikomanagement: VLOPs müssen Risiken wie Desinformation oder algorithmische Verzerrung erkennen und minimieren.
-
Gezielte Werbung: Strenge Regeln für Werbung mit sensiblen Daten oder an Minderjährige.
Folgen für VCs und Startups: Die Nichteinhaltung könnte massive Geldstrafen oder erzwungene betriebliche Änderungen bedeuten.
Zum Beispiel forderte die EU Anfang 2024 von X die Vorlage interner Unterlagen zu ihren Empfehlungssystemen im Rahmen einer DSA-Untersuchung. Während die härtesten DSA-Sanktionen vor allem Technologieriesen betreffen, sollten aufstrebende Plattformen von Anfang an „für Compliance entwerfen“ und Richtlinien zur Inhaltsmoderation sowie Transparenz bei Daten implementieren. Dies verhindert nicht nur regulatorische Prüfungen, sondern signalisiert auch Nutzern (und potenziellen Investoren), dass die Plattform verantwortungsvoll handelt.
5. KI-Verordnung – Innovation zukunftssicher gestalten
Die EU KI-Verordnung trat 2024 in Kraft und wird stufenweise durchgesetzt.
Was gilt bereits?
-
Seit 2. Februar 2025: Verbot von „inakzeptabler“ KI (z. B. Social Scoring, manipulative Verhaltenssteuerung, Echtzeit-Biometrie). Schulungspflichten für Personal.
-
Ab 2. August 2025: Regeln für allgemeine KI-Modelle (Transparenz, Urheberrechte, Dokumentation) sowie Aufbau von Aufsichtsstrukturen und Sanktionen.
Demnächst: Verpflichtungen für Hochrisiko-Künstliche Intelligenz
- Die überwiegende Mehrheit der Verpflichtungen für Hochrisiko-KI, einschließlich Registrierungspflichten, Risikomanagementsystemen, Qualitätskontrollen, technischer Dokumentation, menschlicher Aufsicht und Überwachung nach dem Inverkehrbringen, gilt erst ab dem 2. August 2026.
Compliance als Chance: Vertrauen und Wert schaffen
EU-Vorgaben mögen aufwendig erscheinen, doch für Startups und VCs bieten sie auch Chancen. Eine starke Compliance:
-
Schafft Vertrauen: Kunden und Partner honorieren Datenschutz und sichere Abläufe.
-
Ermöglicht Marktzugang: Wer EU-Regeln erfüllt (DSA, KI-Gesetz), kann ohne Rückbauten skalieren.
-
Zieht Investitionen an: Ein klarer Compliance-Fahrplan verbessert Bewertung und beschleunigt Finanzierungen.
-
Reduziert Risiken: Frühzeitige Rechtskonformität verringert spätere Betriebsunterbrechungen, Bußgelder oder Haftung.
Im regulierten europäischen Umfeld ist Legal Compliance kein Kostenfaktor, sondern ein strategisches Asset. Wer EU-Rechtsstandards verinnerlicht, baut Resilienz, Reputation und nachhaltigen Wert auf. Startups und VCs, die Compliance meistern, können schneller innovieren, grenzüberschreitend wachsen und regulatorisches wie finanzielles Vertrauen gewinnen.