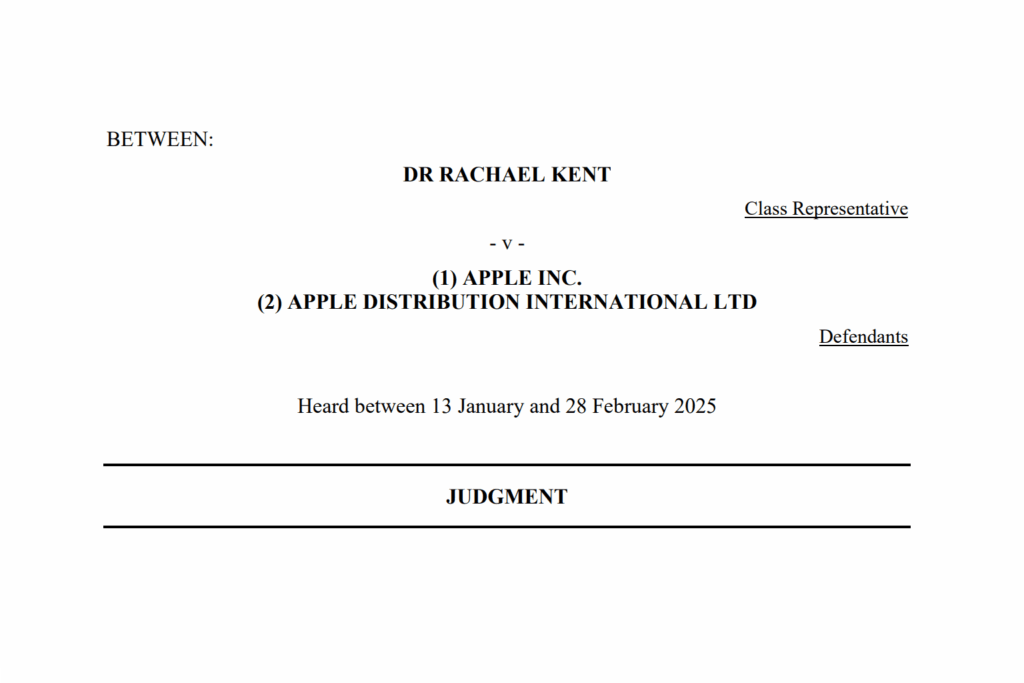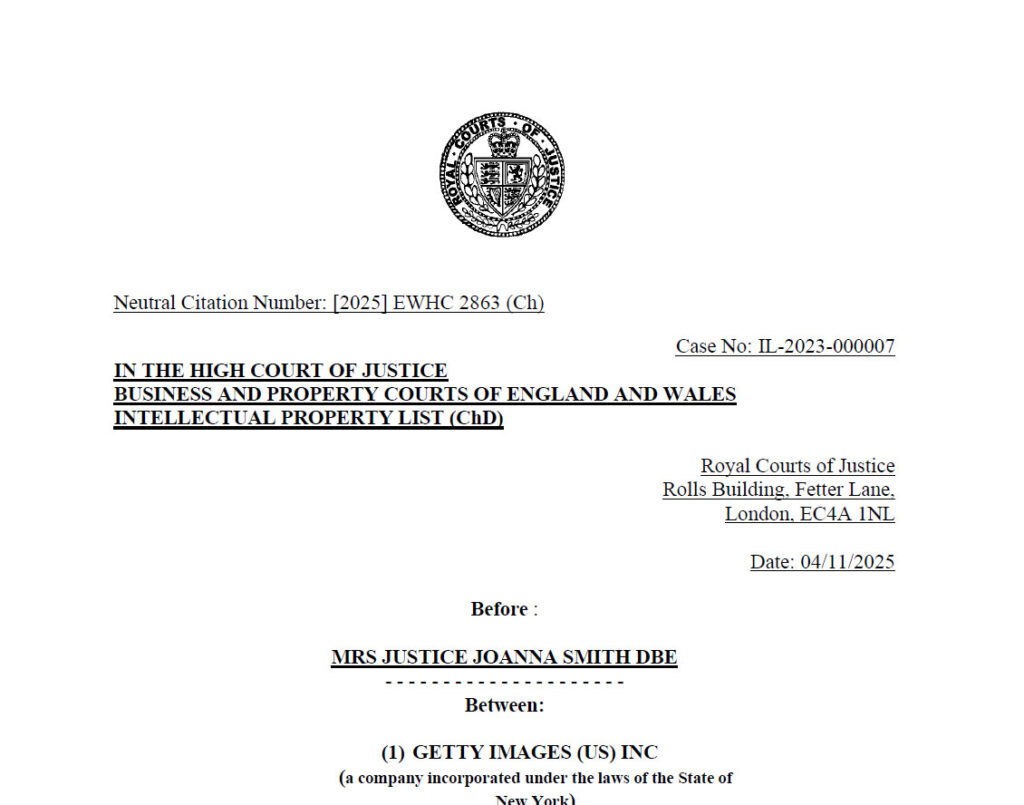Am 23. Oktober 2025 erließ das Competition Appeal Tribunal („das Tribunal“) ein vollständiges, einstimmiges Urteil in der Sache Dr. Rachael Kent gegen Apple Inc. & Apple Distribution International Ltd, in dem festgestellt wurde, dass Apple in zwei eng abgegrenzten britischen Märkten, nämlich dem Markt für iOS-App-Vertriebsdienste und dem Markt für iOS-In-App-Zahlungsdienste, im Zeitraum zwischen dem 1. Oktober 2015 und dem 15. November 2024 eine marktbeherrschende Stellung missbraucht habe. Das Tribunal kam zu dem Ergebnis, dass die vertraglichen und technischen Beschränkungen Apples den Wettbewerb ausschlössen, insbesondere dadurch, dass Apple den In-App-Zahlungsdienst an die Nutzung des App Store knüpfte („Tying“). Ferner stellte das Tribunal fest, dass die von Apple erhobene Provision von 30 % überhöht und unfair sei und dass Apples Rechtfertigungen, wie objektiv notwendige Sicherheits- oder Datenschutzvorteile sowie betriebliche Effizienzargumente, nach der Beweislage nicht durchgriffen. Für die Quantifizierung („quantum“) nahm das Tribunal hypothetische Provisionssätze („counterfactual benchmarks“) von 17,5 % für den App-Vertrieb und 10 % für In-App-Zahlungen an und unterstellte eine Kostenweitergabequote von 50 % an die Endnutzer. Anschließende Verfahren zur genauen Schadens- und Kostenfestsetzung wurden angeordnet.
Bedeutung der Entscheidung
Diese Entscheidung stellt einen Meilenstein im britischen Wettbewerbsrecht dar, und zwar aus drei ineinandergreifenden Gründen:
-
Ein führender Plattformbetreiber wurde sowohl auf Grundlage ausschließender als auch ausbeuterischer Missbrauchstatbestände in eng definierten Plattform-Nachmärkten haftbar gemacht. Dies liefert einen Leitfaden, wie Gerichte klassische Missbrauchskonzepte auf moderne digitale Plattformen anwenden.
-
Das Tribunal wendete die Grundsätze der überhöhten Preisgestaltung („excessive pricing“) auf Plattformprovisionen an und entwickelte konkrete Gegenfaktische (17,5 % und 10 %) sowie eine Durchreichungsquote (50 %), um den aggregierten Verbraucherschaden zu modellieren und gab Marktteilnehmern damit justiziable Planungsgrößen für das Prozessrisiko.
-
Das Urteil präzisiert die Beweisanforderungen für „Sicherheits- und Integritätsrechtfertigungen“: Allgemeine Behauptungen integrierter Sicherheit genügen nicht; Unternehmen müssen enge, verhältnismäßige Zusammenhänge zwischen konkreten Beschränkungen und zusätzlichen Vorteilen nachweisen.
Insgesamt erhöht das Urteil sowohl die prozessualen als auch die Compliance-Risiken für Plattformbetreiber, die Gerätekontrolle, exklusive Vertriebskanäle und gebündelte Zahlungssysteme kombinieren.
Überblick: Das britische wettbewerbsrechtliche Rahmenwerk
Das Tribunal strukturierte seine rechtliche Analyse in der üblichen Vier-Schritt-Prüfung:
-
Marktdefinition,
-
Feststellung der Marktbeherrschung,
-
Nachweis des Missbrauchs (ausschließend und ausbeuterisch), und
-
Prüfung von Rechtfertigungen sowie Schadens- und Abhilfemaßnahmen („defences and quantum“).
Die Klage wurde auf S.18 des Competition Act 1998 (Chapter II) sowie, für den Zeitraum bis zum 31. Dezember 2020, auf Art. 102 AEUV gestützt, da beide Regelungsregime während des Klagezeitraums anwendbar waren.
Zentrale Rechtsgrundsätze und Maßstäbe des Tribunals:
- Marktdefinition: Bleibt eine tatsachenintensive Prüfung unter Anwendung des hypothetischen Monopolisten- bzw. SSNIP-Tests, wobei die sogenannte Cellophane-Fallacy zu vermeiden ist. Das Tribunal betonte die sorgfältige Bewertung praktischer Austauschbarkeit und realer Beschränkungen (technisch, vertraglich, verhaltensbezogen).
- Marktbeherrschung: Bemisst sich nach der wirtschaftlichen Stärke im relevanten Markt. Eine enge Marktdefinition kann zu erheblicher Marktmacht führen, wenn Alternativen keine hinreichenden Substitute darstellen.
- Missbrauch: Klassische Kategorien des ausschließenden Missbrauchs (Exklusivitätsbindungen, Koppelungen, Marktabschottung) und des ausbeuterischen Missbrauchs (überhöhte Preise, unfaire Bedingungen) gelten auch für digitale Plattformen, müssen jedoch wirkungsbasiert („effects-based“) nachgewiesen werden.
- Rechtfertigungen: Ein marktbeherrschendes Unternehmen kann sich auf objektive Notwendigkeit oder Effizienzgewinne berufen, muss jedoch kumulative Nachweise erbringen: Notwendigkeit, Verhältnismäßigkeit, quantifizierbare Effizienzvorteile, die die Wettbewerbsbeschränkung überwiegen.
- Quantifizierung (Quantum): Da kontrafaktische Modellierungen naturgemäß unsicher sind, verfolgt die Rechtsprechung einen pragmatischen Ansatz: die bestmögliche Annäherung anhand der verfügbaren Beweise, ohne Entschädigung wegen fehlender Präzision zu verwehren.
Diese Grundsätze wurden im vorliegenden Fall konkret auf den Plattformkontext angewandt, womit das Urteil eine praktische Vorlage für Prozessvertreter und Compliance-Abteilungen darstellt.
Kurzbeschreibung des Sachverhalts
Die Klage wurde als kollektive Sammelklage erhoben, die etwa 36 Millionen Mitglieder umfasste und britische iOS-Gerätenutzer repräsentiert, die im Zeitraum vom 1. Oktober 2015 bis zum 15. November 2024 kostenpflichtige App- oder In-App-Käufe tätigten.
Die Klage stützte sich auf zwei Haupttheorien des Missbrauchs: (a) ausschließender Missbrauch, weil Apples vertragliche und technische Beschränkungen eine Abschottung („foreclosure“) bewirkten, indem sie den Vertrieb nativer iOS-Apps ausschließlich über den App Store und die Nutzung des Apple-In-App-Zahlungssystems vorschrieben und (b) ausbeuterischer Missbrauch, weil Apple eine überhöhte und unfaire 30 % Provision verlangte, die Verbraucherpreise aufblähte.
Marktdefinition und Marktbeherrschung
Eng abgegrenzte, faktisch bestimmte Märkte
Das Tribunal lehnte weite systembezogene Märkte ab und definierte stattdessen zwei Nachmärkte:
-
den Markt für iOS-App-Vertriebsdienste welcher ein zweiseitiger Markt ist der iOS-Entwickler und iOS-Gerätenutzer für native Apps zusammenführt (Nachmarkt zum Gerätemarkt), und
-
den Markt für iOS-In-App-Zahlungsdienste welcher ein einseitiger Nachmarkt ist, der Transaktionen innerhalb von Apps ermöglicht.
Die Begründung für diese enge Marktdefinition? Das Tribunal prüfte Substitutionsargumente (Web-Apps, geräteübergreifende Käufe, Android/Google Play, Drittanbieter-Marktplätze) sorgfältig und kam zu dem Schluss, dass diese Alternativen keinen hinreichenden Wettbewerbsdruck ausübten. Ausschlaggebend waren vertragliche und technische Barrieren, denen Entwickler und Nutzer gleichermaßen ausgesetzt waren.
Marktbeherrschung als Folge der Marktdefinition
Da die Märkte eng gezogen waren und der App Store alleiniger praktischer Vertriebskanal war, verfügte Apple nach Auffassung des Tribunals über nahezu absolute Marktmacht. Dies wurde durch eine faktische Marktanteilsstellung von nahezu 100 % und hohe vertragliche Zutrittsschranken gestützt.
Die ausschließenden Missbrauchstatbestände
Exklusivitätsbindungen / Marktabschottung
Die Klägerseite argumentierte, dass Apples Developer Program License Agreement (DPLA), die App Review Guidelines und technische Kontrollmechanismen verhinderten, dass Entwickler native iOS-Apps außerhalb des App Store vertreiben oder alternative Zahlungssysteme nutzen.
Das Tribunal bestätigte, dass diese Beschränkungen den Wettbewerb in den definierten Märkten ausschlossen und somit gegen Chapter II CA 1998 / Art. 102 AEUV verstießen.
Bemerkenswert ist, dass das Tribunal Apples Argument einer IP-Reservierung nach Magill/IMS-Logik zurückwies. Apple habe seine Tools und Technologien zwar als geistiges Eigentum bezeichnet, diese jedoch so weit lizenziert, dass keine enge Ausnahme nach der Magill-Doktrin eingreife. Die Beschränkungen seien eigenständige wettbewerbsbeschränkende Maßnahmen.
Koppelung („Tying“)
Das Tribunal wandte den klassischen Vier-Stufen-Test an:
-
Liegen getrennte Produkte vor?
-
Besteht eine marktbeherrschende Stellung beim Koppelungsprodukt?
-
Besteht keine Wahlmöglichkeit, das Koppelungsprodukt ohne das gekoppelte Produkt zu erwerben?
-
Treten Verdrängungs- oder Abschottungseffekte auf?
Es stellte fest, dass Apple seine In-App-Zahlungsdienste (das gekoppelte Produkt) an den App Store-Vertrieb (das Koppelungsprodukt) band, da Entwickler faktisch keine Dritt-Zahlungsoptionen verwenden konnten. Dadurch wurde der Wettbewerb im Zahlungs-Nachmarkt ausgeschlossen.
Praxisrelevanz: Vertragliche oder technische Maßnahmen, die die Nutzung eigener Zahlungssysteme erzwingen oder Alternativrouten erheblich beschränken, begründen Koppelungsrisiken, sofern der Betreiber in einem Markt dominant ist.
Die ausbeuterischen Missbrauchstatbestände
Nach Feststellung des ausschließenden Missbrauchs prüfte das Tribunal gesondert den ausbeuterischen Charakter der 30 %-Provision und der zugehörigen Gebührenstruktur.
Es folgte einer zweistufigen Analyse:
-
Ermittlung eines angemessenen Vergleichspreises („non-abusive benchmark“), und
-
Bewertung, ob der tatsächliche Preis unfair ist im Verhältnis zu diesem Benchmark, zu Kosten/Erträgen und zu Vergleichsmärkten.
Die Methodik des Tribunals
Das Tribunal wandte einen zweigliedrigen Ansatz an in Bezug auf ausbeuterische Preisgestaltung. Zunächst suchte es nach einem wirtschaftlich sinnvollen kontrafaktischen Preis, d. h. einer Gebühr, die in einem wettbewerbsorientierten oder nicht missbräuchlichen Markt ohne rechtswidrige Beschränkungen üblich gewesen wäre. Angesichts der Schwierigkeit, über einen mehrjährigen Klagezeitraum hinweg ein exaktes kontrafaktisches Preismodell zu erstellen, verfolgte das CAT einen pragmatischen, faktenbasierten Ansatz und nutzte die besten verfügbaren Vergleichsbeweise, Expertenmodelle und Marktstrukturanalysen, um zu angemessenen, nicht missbräuchlichen Benchmarks zu gelangen.
Zweitens prüfte das Gericht die Fairness anhand von Gewinnspannen, Kostenverteilung, Vergleichsplattformen und der Beständigkeit der Renditen. Hohe, anhaltende Margen bei einem zentralen Gatekeeper-Dienst, sofern sie nicht durch transparente Kostenbegründungen oder gegenläufige Verbrauchervorteile gestützt wurden, untermauerten die Schlussfolgerung, dass die Gebühren ausbeuterisch waren.
Die festgelegten Benchmarks:
-
App-Vertriebsdienste: 17,5 % – Provision
-
In-App-Zahlungsdienste: 10 % – Provision
Diese Werte wurden als plausible Wettbewerbsniveaus in einem nicht missbräuchlichen Markt angesehen und dienten nur der Schadensbemessung, nicht als generelle Obergrenzen.
Bewertung von Fairness, Kosten und Gewinnen
Das Tribunal analysierte Apples interne Kostenallokation (Programmentgelte, Tools, Provisionen) sowie Vergleichspreise anderer Plattformen. Fehlende nachvollziehbare Rechtfertigungen für die hohen Margen deuteten auf Ausbeutung hin. Gleichwohl betonte das Tribunal, dass wirtschaftliche Fundierung unabdingbar sei. Hohe Preise allein seien kein Beweis.
Kostenweitergabe und Gesamtauswirkung
Für die Schadenersatzforderung benötigte das Competition Appeal Tribunal eine glaubwürdige Annahme zur Inzidenz, d. h. zum Anteil der vom Endverbraucher zu tragenden Mehrkosten. Angesichts konkurrierender Expertenmeinungen entschied sich das Tribunal für einen pragmatischen Mittelwert von 50 %. Diese Annahme bedeutete, dass die Hälfte der Differenz zwischen Apples tatsächlicher Provision und den kontrafaktischen Benchmarks als an die Verbraucher weitergegeben und somit insgesamt erstattungsfähig behandelt würde. Das Tribunal verwies auf die inhärente Unsicherheit der Durchrechnungsmodellierung und begründete seinen Ansatz als angemessenen Kompromiss im Interesse der Entschädigung.
Wesentliche Nuancen und Vorbehalte
-
Fallbezogenheit: Die Werte 17,5 % und 10 % sind fallspezifisch und keine allgemeine Grenze.
-
Pragmatismus: Das Tribunal erkannte die Unsicherheiten bei der Modellierung und verfolgte ausdrücklich einen pragmatischen Ansatz, um zu vermeiden, dass der Mangel an absoluter Präzision eine Abhilfe verhindert. Diese pragmatische Haltung bedeutet, dass unterschiedliche Beweissätze in anderen Fällen zu wesentlich anderen kontrafaktischen Aussagen führen könnten.
-
Ergänzende Bedeutung von Gewinnnachweisen: Dauerhafte Überrenditen allein sind kein Grund für Ungerechtigkeit, stellen aber in Kombination mit Benchmark- und Vergleichsbeweisen ein wichtiges bestätigendes Indiz dar.
Praxis Implikationen: Plattformbetreiber sollten transparente Kostenstrukturen und nachvollziehbare Verknüpfungen zwischen Gebühren und Leistungen (z. B. Betrugsprävention, Abrechnung, SDKs, Vertrieb) dokumentieren. Gebühren, die vergleichbare Werte deutlich übersteigen, sind besonders rechtfertigungsbedürftig.
Preisstrategien sollten anhand plausibler Gegenfaktoren und Vergleichsplattformen auf Risiko geprüft werden; die im Urteil genannten Benchmarks dienen als Stresstest-Szenarien.
Regulatorische Folgen und grenzüberschreitende Wechselwirkungen
Obwohl es sich um eine private Sammelklage handelte, bezog sich das Tribunal ausführlich auf Regulierungsdokumente (CMA-Marktuntersuchung, Entscheidungen nationaler Wettbewerbsbehörden, EU-Kommission). Dadurch wird das Urteil voraussichtlich in Regulierungsverfahren und ausländischen Verfahren zitiert und Auswirkungen auf Compliance-Erwartungen unter ex-ante-Regimen (z. B. Digital Markets Act) haben.
Unternehmen sollten daher öffentliche Durchsetzung und private Klagen als gleichwertige Risiken begreifen und koordiniert darauf reagieren.
Schlussfolgerung
Dr Rachael Kent v Apple ist ein Weckruf: Das Tribunal hat verdeutlicht, dass das moderne Wettbewerbsrecht auch gegenüber Plattform-Gatekeepern in UK effektiv durchgesetzt wird. Vertragliche Gestaltung, technische Architektur und Preisstrukturen unterliegen einer strengen wettbewerbsrechtlichen Kontrolle und müssen beweisgestützt vertretbar sein. Das Urteil verbietet Integration nicht, erhöht aber die Beweisanforderungen für pauschale Verbote und unsubstantiierte Gebührenmodelle.
Für Plattformbetreiber gilt: Notwendigkeit belegen, Verhältnismäßigkeit dokumentieren, Preis- und Kostenstrukturen offenlegen und Wahlmöglichkeiten ermöglichen. Für Entwickler und Marktneueinsteiger ist die Entscheidung eine Bestätigung, dass strukturelle Marktzutrittsschranken rechtswidrig sein können und dass Wettbewerb durch gerichtliche oder regulatorische Maßnahmen wiederhergestellt werden kann.