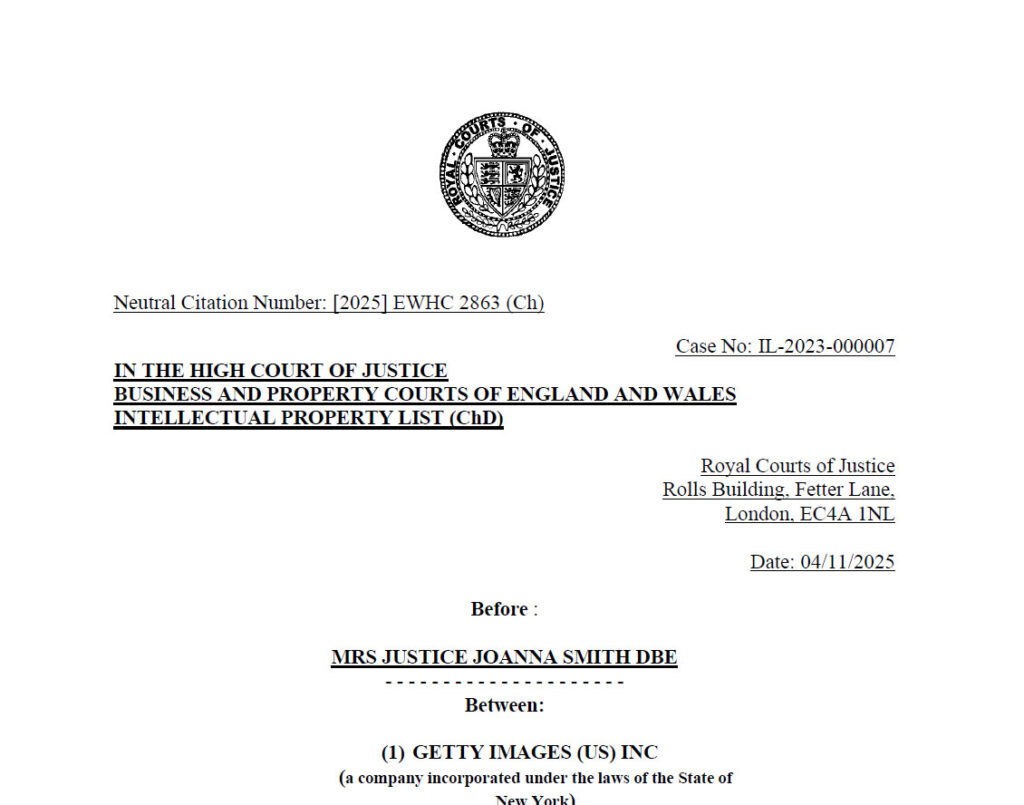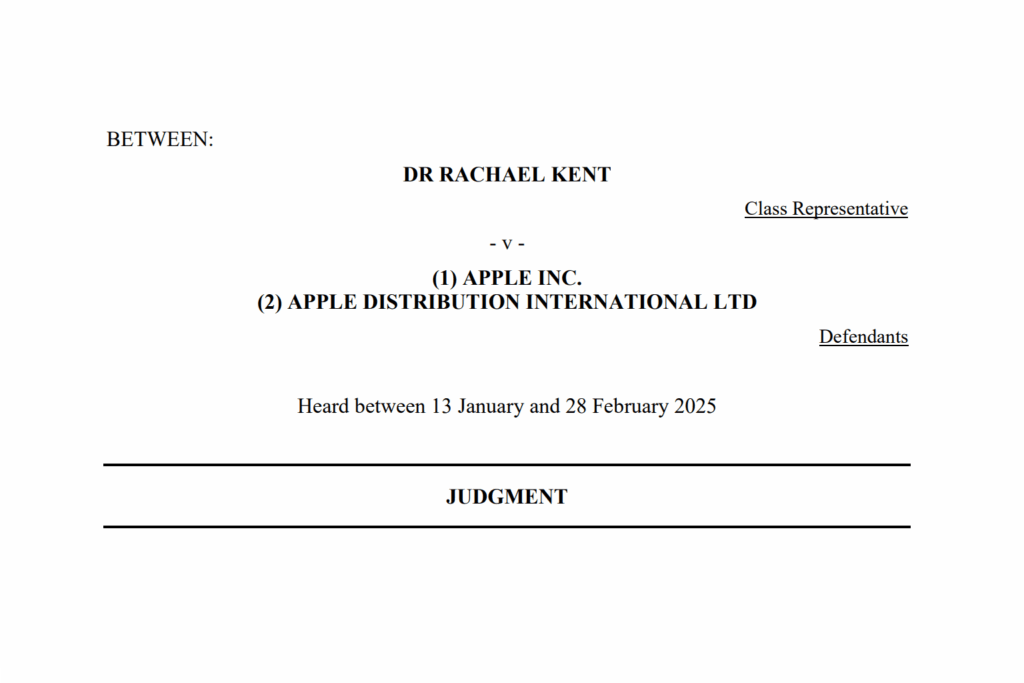In einer kartellrechtlichen Entscheidung hat die Europäische Kommission am 5. September 2025 Google wegen Missbrauchs seiner marktbeherrschenden Stellung im Bereich der Online-Werbetechnologien (AdTech) mit einer Geldbuße in Höhe von 2,95 Milliarden Euro belegt. Dies ist bereits die vierte große Kartellstrafe gegen Google in der EU. Die Kommission stellte fest, dass Google gegen das EU-Kartellrecht verstoßen hat, indem es den Wettbewerb in der Werbetechnologiebranche „verzerrte“ und „seine eigenen digitalen Werbedienste bevorzugte“.
Neben der Geldstrafe ordnet die Entscheidung an, dass Google seine „Selbstbevorzugungspraktiken“ beendet und die „inhärenten Interessenkonflikte“ in seiner AdTech-Lieferkette beseitigt. Angesichts der Wortwahl der Pressemitteilung scheint die EU-Kommission strukturelle Abhilfemaßnahmen zu bevorzugen.
Die Entscheidung hat weitreichende Bedeutung für die Durchsetzung des Wettbewerbs im digitalen Bereich. Sie zeigt, dass Brüssel entschlossen ist, wettbewerbswidriges Verhalten marktbeherrschender Plattformen anzugehen, und unterstreicht, dass führende Technologieunternehmen strengen EU-Kartell- und Digitalmarktvorschriften unterliegen. Bemerkenswert ist zudem, dass diese Strafe in einer Phase verschärfter Spannungen zwischen den USA und der EU über die Regulierung von Big Tech erfolgt und möglicherweise einen Präzedenzfall für die Rechtsdurchsetzung schafft.
Zentrale Konzepte des EU-Wettbewerbsrechts
Ein kurzer Überblick über zentrale Prinzipien des EU-Wettbewerbsrechts, um den Fall besser zu verstehen:
- Marktabgrenzung: Der erste Schritt besteht darin, den relevanten Produkt- und geografischen Markt zu identifizieren, in dem der Wettbewerb bewertet wird. Der Produktmarkt umfasst alle Dienstleistungen, die Verbraucher auf Grundlage von Eigenschaften, Preisen und Nutzung als substituierbar ansehen. Der geografische Markt ist das Gebiet, in dem Anbieter unter ähnlichen Wettbewerbsbedingungen operieren. In der Praxis gelten hohe Marktanteile und Marktzutrittsschranken als starke Indikatoren für Marktmacht.
- Marktbeherrschung: Sobald die Märkte definiert sind, wird die marktbeherrschende Stellung eines Unternehmens bewertet. Ein marktbeherrschendes Unternehmen kann weitgehend unabhängig von Wettbewerbern, Kunden oder Verbrauchern handeln. Die Kommission berücksichtigt u. a. Marktanteil, technologische Führerschaft, vertikale Integration und Eintrittsbarrieren. Entscheidend: Marktbeherrschung ist nach Art. 102 AEUV nicht automatisch illegal, aber ein marktbeherrschendes Unternehmen trägt eine „besondere Verantwortung“, den Wettbewerb nicht zu verzerren.
- Missbrauch der Marktbeherrschung (Art. 102 AEUV): Tritt auf, wenn ein marktbeherrschendes Unternehmen ausbeuterische oder ausschließende Praktiken anwendet, die den Wettbewerb schädigen. Beispiele: Weigerung, mit Wettbewerbern zu kooperieren, Kopplung/Bündelung von Produkten, Verdrängungspreise oder überhöhte Preise. In digitalen Märkten stehen ausschließende Missbräuche oft im Vordergrund, weil sie Konkurrenten verdrängen oder Marktzutritt verhindern. Art. 102 AEUV enthält keinen abschließenden Katalog; Gerichte prüfen flexibel, ob das Verhalten „vom Wettbewerb auf der Grundlage von Leistung abweicht“ und effiziente Wettbewerber ausschließt oder beeinträchtigt.
Was bedeutet „Selbstbevorzugung“?
Die sich entwickelnde Doktrine der „Selbstbevorzugung“ steht im Mittelpunkt des vorliegenden Falls. Sie liegt vor, wenn ein marktbeherrschender Plattformbetreiber seine eigenen Produkte oder Dienste gegenüber denen von Wettbewerbern bevorzugt.
Ein Präzedenzfall ist die Google-Shopping-Entscheidung von 2017, in der Google seine eigene Produktsuchmaschine in den allgemeinen Suchergebnissen prominenter platzierte als konkurrierende Dienste. Die Kommission verhängte damals eine Geldbuße von 2,42 Milliarden Euro. Das Gericht der EU und der EuGH bestätigten, dass „Selbstbevorzugung“ gegen Art. 102 verstoßen kann, wenn sie „außerhalb des Leistungswettbewerbs“ liegt und ausschließende Effekte erzeugt. Mit anderen Worten: Eine Plattform darf eigene Inhalte auf nichtdiskriminierender Basis einbinden oder bewerben, aber wenn sie ihre Plattformmacht nutzt, um eigene Dienste in einer Weise zu bevorzugen, die gleich effiziente Wettbewerber behindert, kann dies rechtswidrig sein. Ob „Selbstbevorzugung“ missbräuchlich ist, hängt vom Marktkontext, den Auswirkungen auf den Traffic, der Wechselmöglichkeit der Nutzer usw. ab.
Zusammenfassung und Analyse der aktuellen AdTech-Entscheidung
Die Entscheidung der Kommission im aktuellen Verfahren AT.40670 („Google AdTech“) konzentriert sich auf Googles Online-Displaywerbungsgeschäft, einschließlich der Tools, die Google für die Schaltung und den Einkauf von Anzeigen im offenen Web bereitstellt. Praktisch besteht der AdTech-Stack von Google aus mindestens drei Ebenen:
-
Publisher-Adserver (DoubleClick for Publishers, DFP/Ad Manager): Software, mit der Webseiten- und App-Publisher Anzeigen verwalten und ausspielen. Googles DFP ist der am weitesten verbreitete Adserver in Europa.
-
Ad Exchange (Google AdX): Programmatic-Marktplatz, auf dem Publisher-Inventar versteigert wird.
-
Werbeplattformen (Google Ads und Display & Video 360): Tools für Werbetreibende und Agenturen, um Display-Anzeigen einzukaufen.
Die Kommission stellte fest, dass diese Infrastruktur vertikal integriert ist und Google somit an fast jedem Punkt der Display-Werbekette präsent ist. Publisher nutzen die Ad-Server und die Börse des Unternehmens, um Bannerwerbung zu verkaufen, während Werbetreibende die Einkaufstools des Unternehmens nutzen, um Anzeigen zu platzieren. Das bedeutet, dass Google oft zwischen Käufer und Verkäufer einer Anzeige vermittelt. Kurz gesagt: Google fungiert gleichzeitig als Anzeigenkäufer, Anzeigenverkäufer und Marktplatzbetreiber.
Die Untersuchung ergab, dass Google auf dem Markt für Publisher-Adserver und auf dem Markt für programmatische Anzeigeneinkaufstools für das offene Web eine beherrschende Stellung innehat. Darüber hinaus verfügt Google aufgrund seiner Datenbestände und bestehenden Beziehungen zu Werbetreibenden und Publishern über erhebliche Markteintrittsbarrieren und enorme finanzielle Ressourcen. Zusammenfassend stellte die Kommission fest, dass Google im gesamten Untersuchungszeitraum (von 2014 bis heute) auf diesen Märkten eine beherrschende Stellung innehatte und in der Lage war, den Wettbewerb zu verzerren.
Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung. Die zentrale Befund ist, dass Google seine Dominanz missbraucht hat, indem es in seinem Ad-Tech-Stack „Selbstpräferenzen“ zum Nachteil von Publishern, Werbetreibenden und konkurrierenden Ad-Tech-Unternehmen verfolgte. Konkret hat Google offenbar Folgendes getan:
-
-
seinen eigenen Exchange (AdX) bevorzugt, indem Google Ads und DV360 Wettbewerbsbörsen umgingen,
-
Daten aus seinem Adserver genutzt, um eigene Bietstrategien zu optimieren und AdX Vorteile gegenüber Konkurrenten zu verschaffen.
-

Illustration der EU-Kommission.
Diese Praktiken führten dazu, dass mehr Anzeigenimpressionen bei Google landeten, höhere Gebühren anfielen und Publisher/Wettbewerber Einnahmen verloren. Googles Selbstbevorzugung weicht vom Wettbewerb auf der Grundlage von Leistung ab und schließt effiziente Wettbewerber aus – ein typisches Beispiel für einen Leveraging-Abuse nach Art. 102 AEUV.
Berechnung der Geldbuße. Nach den Leitlinien von 2006 wird die Höhe anhand von Schwere, Dauer und Zahlungsfähigkeit berechnet. Die 2,95 Mrd. € reflektieren die erheblichen Markteffekte und die lange Dauer (über ein Jahrzehnt). Außerdem wurde die Strafe vermutlich wegen Googles wiederholter Kartellverstöße erhöht.
Abhilfemaßnahmen. Google muss Selbstbevorzugung sofort beenden und Interessenkonflikte beseitigen. Innerhalb von 60 Tagen muss Google Vorschläge zur Einhaltung einreichen. Die Kommission kann dann Dritte konsultieren und entweder die Vorschläge akzeptieren oder eigene Maßnahmen verhängen. Die bevorzugte Lösung: eine strukturelle Trennung, z. B. Verkauf von AdX und/oder DFP, falls Googles Vorschläge nicht ausreichen.
Googles bisherige EU-Kartellbilanz
Diese AdTech-Strafe ist das jüngste Kapitel in einer langjährigen Auseinandersetzung zwischen Google und Brüssel. Das Unternehmen war Ziel mehrerer bedeutender EU-Kartelluntersuchungen. Bemerkenswerte Fälle sind:
-
Google Shopping (2017): Strafe 2,42 Mrd. €, bestätigt vom EuG und EuGH 2024.
-
Android (2018): Strafe 4,34 Mrd. €, wegen Kopplung von Suche und Browser an Android. Höchste EU-Kartellstrafe. Strafe wird angefochten, auf Berufung leicht reduziert.
-
AdSense (2019): Strafe 1,49 Mrd. €, wegen Einschränkungen für Drittanbieter-Websites. Urteil 2024 aufgehoben, aktuell Berufung beim EuGH.
Googles bisherige US-Kartellbilanz
Die AdTech-Entscheidung von Google fällt in den Kontext paralleler Kartellrechtsstreitigkeiten in den USA. Dort verfolgt das US-Justizministerium Google sowohl in den Bereichen Suche als auch Werbung, doch die Abhilfemaßnahmen unterscheiden sich bislang deutlich vom Ansatz der EU.
Im Suchmaschinenmarkt entschied der US-Bezirksrichter Amit Mehta in Washington, D.C. im Fall U.S. v. Google im August 2024 im Verfahren USA gegen Google, dass Google illegal ein Monopol in der Online-Suche und den damit verbundenen Werbemärkten aufrechterhält. Das Gericht kam zu dem Schluss, dass Google Milliarden von Dollar investiert hatte, um seine Suchmaschine zur Standardsuchmaschine auf den meisten Geräten zu machen und so einen Marktanteil von fast 90 % zu sichern.
In der Abhilfephase lehnte der US-Richter die Forderung des Justizministeriums nach einer Aufspaltung jedoch weitgehend ab. In einer Verfügung vom September 2025 erlaubte Mehta Google, wichtige Vermögenswerte wie den Chrome-Browser und das Android-Betriebssystem zu behalten, verhängte jedoch Verhaltensauflagen. Er ordnete an, dass Google mehr Suchdaten mit Konkurrenten teilt, um den Wettbewerb zu fördern. Tatsächlich erreichte Mehta einige Zugeständnisse (einen besseren Datenzugriff), verzichtete jedoch auf strukturelle Abhilfemaßnahmen. Im US-Suchmaschinenfall lag der Schwerpunkt daher eher auf Verhaltenskorrekturen als auf einer erzwungenen strukturellen Veräußerung.
Im Gegensatz dazu spiegelt die Klage des Justizministeriums gegen Googles AdTech-Aktivitäten (das Verfahren „United States et al. v. Google“, eingereicht beim US-Bezirksgericht für den östlichen Bezirk von Virginia, die Haltung der EU eher wider. Im Mai 2025 setzte Richterin Leonie Brinkema vom östlichen Bezirk von Virginia einen Verhandlungstermin (den 22. September 2025) an, um speziell über Abhilfemaßnahmen in dem Fall zu beraten. Das Justizministerium strebt ausdrücklich den Verkauf von Googles Publisher-Ad-Server und Ad-Exchange an (dieselben Produkte, um die es im EU-Fall geht). Mit anderen Worten: Wie Brüssel scheint auch die US-Regierung auf eine strukturelle Trennung von Googles Buy-Side- und Sell-Side-Plattformen zu drängen. Die Anordnung von Richterin Brinkema, ein Verfahren zur Abhilfe anzuordnen, deutet darauf hin, dass im US-amerikanischen Verfahren die Haftung bereits festgestellt wurde (Googles Verhalten wird als wettbewerbswidrig angesehen) und sich nun auf die Wiederherstellung des Wettbewerbs konzentriert. Der Kontrast ist aufschlussreich. Im Suchmaschinenverfahren entschied sich das US-System für schrittweise Abhilfemaßnahmen; im Adtech-Verfahren scheint es bereit zu sein, ein drastischeres Ergebnis in Kauf zu nehmen.
Die Entscheidung der EU spiegelt ebenfalls die Bereitschaft wider, bei Bedarf strukturelle Abhilfemaßnahmen zu ergreifen, analog zur Strategie des Justizministeriums im Adtech-Verfahren. In beiden Rechtsräumen deutet das Zusammenspiel dieser Fälle auf eine schwierige Ära der Kartellrechtsdurchsetzung hin. Die Regulierungsbehörden signalisieren nicht nur, dass marktbeherrschende digitale Plattformen für ihre Selbstbevorzugung sanktioniert werden können, sondern auch, dass aktiv angestrebte Abhilfemaßnahmen die Zerschlagung von Unternehmensteilen umfassen, wenn sich Verhaltensänderungen als unzureichend erweisen.
Praktische Implikationen
Diese Entscheidung der Kommission wirft wichtige rechtliche und praktische Fragen auf. Erstens ist die festgestellte Schadensform, die „Selbstbevorzugung“ in einer komplexen, mehrseitigen Anzeigenbörse, relativ neuartig. Im Gegensatz zu klassischen Missbrauchsfällen wie Abschottung oder Predation bestand der behauptete Schaden hier darin, dass Googles integrierte Adtech-Kette es dem Unternehmen ermöglichte, den Wettbewerb teilweise auszuschließen und gleichzeitig Kunden zu bedienen. Wirtschaftlich gesehen führte Googles Verhalten dazu, dass Verlage in Auktionen effektiv gegeneinander antraten, was ihre Einnahmen reduzierte, und Werbetreibende mit einem verzerrten Einkaufsumfeld konfrontiert waren. Ein solcher „interner Konflikt“ beeinträchtigt den Anreiz der Verlage, sich auf unabhängige Börsen zu verlassen. Die Analyse der Kommission impliziert, dass vertikale Integration durch ein Monopol missbräuchlich sein kann, selbst wenn der Zugang nicht gänzlich verweigert wird, solange die Zugangsbedingungen für die Konkurrenz unfair sind. In der Praxis zeigt das Urteil, dass das EU-Wettbewerbsrecht algorithmische und technische Details des Plattformverhaltens beeinflussen kann und wird.
Zweitens verdeutlicht der Fall die Abhilfestrategie der Kommission. Das EU-Recht bietet sowohl verhaltensbezogene als auch strukturelle Instrumente. In den letzten Jahren hat die Kommission in digitalen Fällen typischerweise verhaltensbezogene Verpflichtungen akzeptiert. Beispielsweise verlangten die Entscheidungen in den Fällen Google Android und Google AdSense von Google, Verträge oder Schnittstellen zu ändern. Diese Entscheidung signalisiert jedoch eine härtere Gangart. Die Kommission hat offen erklärt, dass eine Veräußerung ihre „bevorzugte Option“ sei, falls Googles Lösungen scheitern. Rechtlich gesehen warnt die Kommission Google damit, dass sie das Unternehmen, sollte eine freiwillige Selbstverpflichtung nicht ausreichen, zur Ausgliederung eines Teils des Anzeigengeschäfts zwingen könnte. Dies entspricht dem Ansatz des Justizministeriums und zeigt eine Annäherung an strukturelle Abhilfemaßnahmen für etablierte Plattformmacht.