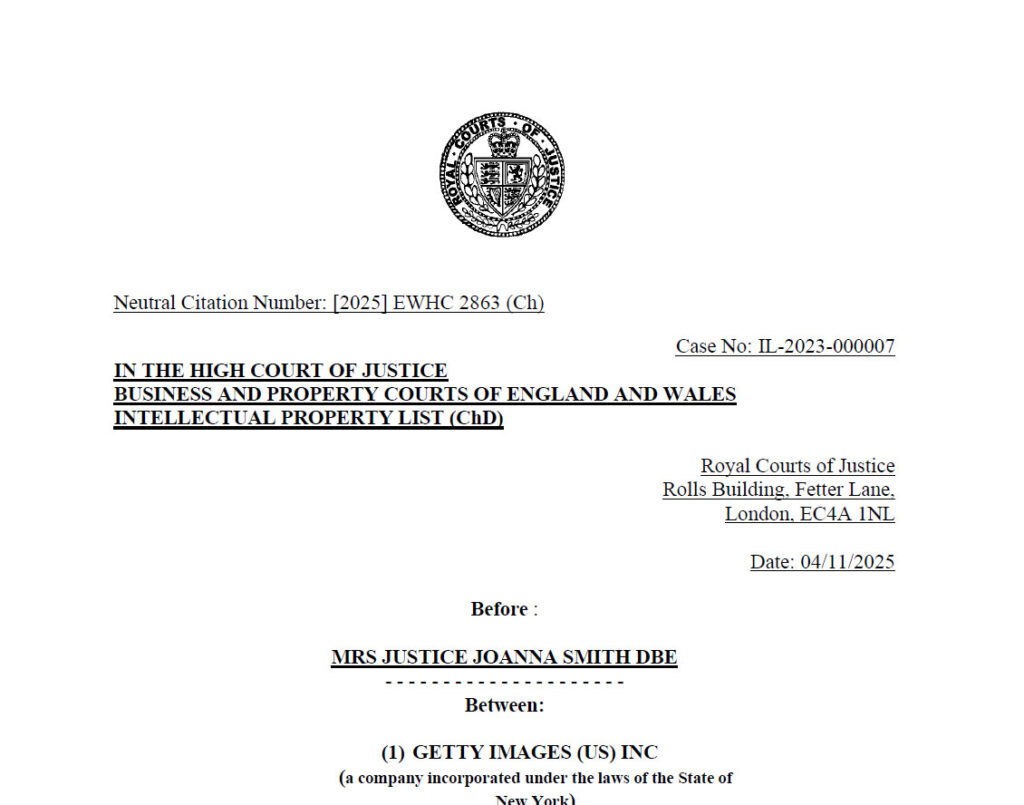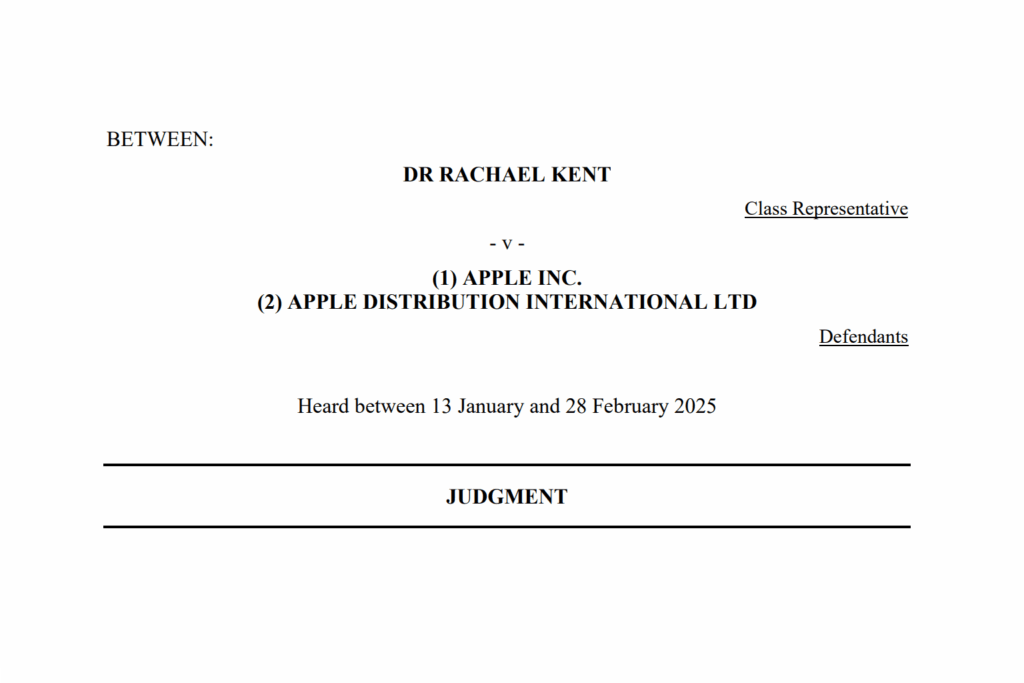Am 14. Oktober 2025 stellte die Europäische Kommission fest, dass Gucci, Chloé und Loewe die Freiheit unabhängiger Händler, Einzelhandelspreise festzusetzen (Wiederverkaufspreisbindung, „Resale Price Maintenance“, RPM), sowohl im Online- als auch im stationären Geschäft rechtswidrig eingeschränkt haben, und verhängte zusammengefasst Bußgelder in Höhe von 157,4 Mio. € (nach Reduzierungen wegen Kooperation). Die Kommission wertete die Praxis als fortgesetzten Verstoß gegen Artikel 101 AEUV und nutzte ihr Kooperationsverfahren, um Zugeständnisse und zusätzliche Beweismittel zu sichern; dies führte zu erheblichen Bußgeldermäßigungen für die kooperierenden Parteien. Die Entscheidungen bekräftigen, dass RPM, einschließlich Eingriffen in Rabattregelungen und Festlegungen zum Zeitpunkt von Sonderverkäufen sowie aktive Überwachung und Nachverfolgung von Händlern, weiterhin ein besonders risikoreiches Verhalten nach Unionsrecht darstellt. Sie schärfen außerdem die praktische Abgrenzung zwischen zulässigem selektiven Vertrieb, der das Markenimage schützen kann, und unzulässiger Preissteuerung.
Der rechtliche Rahmen
Artikel 101 AEUV
Artikel 101 Absatz 1 AEUV verbietet „Vereinbarungen, Beschlüsse und aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen“ zwischen Unternehmen, die den Handel zwischen Mitgliedstaaten beeinflussen können und als Ziel oder Wirkung die Verhinderung, Beschränkung oder Verzerrung des Wettbewerbs im Binnenmarkt haben. Trifft eine Vereinbarung unter Artikel 101 Abs. 1, ist sie nichtig; eine Freistellung nach Artikel 101 Abs. 3 kommt nur in Betracht, wenn die dort genannten Voraussetzungen erfüllt sind.
Wesentliche Tatbestandsmerkmale in RPM-Fällen sind daher:
-
-
das Vorliegen einer „Vereinbarung“ oder einer aufeinander abgestimmten Verhaltensweise zwischen unabhängigen Marktteilnehmern (einschließlich vertikaler Vereinbarungen zwischen Herstellern und unabhängigen Wiederverkäufern),
-
eine Auswirkung auf den Handel zwischen Mitgliedstaaten, und
-
ein wettbewerbsfeindlicher Tatbestand entweder wegen seines Ziels (zum Beispiel Preisabsprachen) oder seiner Wirkung. Ob eine Vereinbarung als objektwidrig angesehen wird, ist entscheidend, weil objektwidrige Verstöße eine Vermutung der Rechtswidrigkeit begründen und in der Regel härtere Sanktionen nach sich ziehen.
-
Durchsetzungsrahmen: Verordnung Nr. 1/2003
Der Verfahrens- und Durchsetzungsrahmen für die Anwendung der Artikel 101 und 102 AEUV ist in der Verordnung Nr. 1/2003 und der zugehörigen Durchführungs-Praxis geregelt. Die Verordnung sieht eine dezentralisierte Durchsetzung vor (Nationale Wettbewerbsbehörden und nationalen Gerichte) und legt die Befugnisse der Kommission fest, einschließlich Untersuchungen, Durchsuchungen und Bußgeldern.
Wiederverkaufspreisbindung im EU-Kartellrecht
Die Festsetzung oder Einschränkung von Verkaufspreisen durch einen Lieferanten gegenüber unabhängigen Wiederverkäufern gilt historisch als prototypische wettbewerbsbeschränkende Maßnahme. Preisabsprachen werden als schwerwiegende Verletzung von Artikel 101 angesehen. Wenn Hersteller direkt oder indirekt Wiederverkaufspreise festlegen (festgelegte oder Mindestsätze, Beschränkungen von Rabatten oder Mechanismen, die Preiswettbewerb ausschalten), wird dies typischerweise als objektwidriger Verstoß (also Preisfestsetzung) und damit als rechtswidrig eingestuft. Die kartellrechtlichen Instrumente der Kommission (Durchsuchungen, Vorwürfe, Entscheidungen) und ihre Bußgeldpraxis spiegeln die Schwere dieses Verhaltens wider.
Festgestellte Sachverhalte der Kommission
Die Kommission stellte in allen drei Fällen fest, dass die Marken die Freiheit unabhängiger Händler, die Verkaufspreise für sämtliche oder Teile ihres Sortimentes im EWR festzulegen, eingeschränkt hatten. Zu den Beschränkungen zählten unter anderem die Durchsetzung von unverbindlichen Preisempfehlungen, Obergrenzen für Rabatte, Vorgaben zu Zeiträumen für Verkaufsaktionen und in einigen Fällen vorübergehende Rabattverbote. Die Kommission stellte außerdem fest, dass die Marken die Preisgestaltung der Händler überwachten und einschritten, wenn Händler von den Vorgaben abwichen.

Abbildung: Europäische Kommission.
Die Beschränkungen bezogen sich sowohl auf stationären Handel als auch auf Online-Verkäufe. Gucci forderte zudem in mindestens einem Fall, dass Händler eine bestimmte Produktlinie nicht online anbieten, und die betreffenden Händler kamen dieser Aufforderung nach.
Dauer
Die Kommission qualifizierte die Verstöße als fortlaufend; diese endeten erst nach den unangekündigten Durchsuchungen der Kommission (sogenannte Dawn Raids) im April 2023. Die berichteten relevanten Zeiträume waren:
Gucci: April 2015 bis April 2023
Loewe: Dezember 2015 bis April 2023
Chloé: Dezember 2019 bis April 2023
Eigenständigkeit der Fälle
Die drei Unternehmen handelten unabhängig voneinander (kein Kartell zwischen ihnen). Aufgrund überlappender Händlerkreise und des gleichen Marktsegments (Luxusmode) behandelte die Kommission die Verfahren jedoch gemeinsam.
Durchsetzungsergebnis und Bußgelder
Die Kommission stellte in jedem Fall einen einzelnen und fortlaufenden Verstoß gegen Artikel 101 AEUV (und Artikel 53 des EWR-Abkommens) fest.
Bußgelder nach Ermäßigungen wegen Kooperation:
Gucci: 119.674.000 € (50 % Ermäßigung wegen Kooperation)
Chloé: 19.690.000 € (15 % Ermäßigung)
Loewe: 18.009.000 € (50 % Ermäßigung)
Die Kommission wandte ihr Kooperationsverfahren an, das an die Praxis von Kartellvergleichsverfahren angelehnt ist, und kürzte die Bußgelder, wenn Unternehmen einen erheblichen Mehrwert für die Aufklärung lieferten (beispielsweise enthüllte Gucci einen der Kommission zuvor unbekannten Verstoß; die Kooperation von Loewe erweiterte den zeitlichen Untersuchungsrahmen). Alle drei Unternehmen erkannten die festgestellten Tatsachen ausdrücklich an.
Ähnliche Fälle aus der Branche
In der Rechtssache C-230/16 Coty (Urteil von 2017) befasste sich der Gerichtshof mit der Abgrenzung zwischen zulässigem selektivem Vertrieb und unzulässigen Beschränkungen von Internetverkäufen. Der Gerichtshof stellte fest, dass ein Lieferant seine Händler unter bestimmten Voraussetzungen untersagen darf, Drittanbieter-Onlineplattformen (etwa Marktplätze, Drittverkäufer) zu nutzen, wenn dieses Verbot erforderlich ist, um das Luxusimage der Waren zu wahren. Voraussetzung ist, dass die Auswahlkriterien objektiv, nicht diskriminierend und verhältnismäßig sind und das Verbot nicht einem allgemeinen Internetverkaufsverbot gleichkommt.
Coty ist insofern bedeutsam, als die Entscheidung anerkennt, dass gewisse qualitative Beschränkungen zur Wahrung des Markenimages mit dem EU-Wettbewerbsrecht vereinbar sein können, sofern sie angemessen begründet sind. Coty legalisiert jedoch nicht RPM oder Preisabsprachen. Das Urteil wird von Luxusmarken häufig herangezogen, um bestimmte Beschränkungen im Online-Vertrieb zu rechtfertigen; es ist aber eng auszulegen. Zulässig sind demnach qualitative, objektive und verhältnismäßige Auswahlkriterien zur Imagewahrung. Nicht zulässig sind hingegen die Festlegung von Wiederverkaufspreisen oder Maßnahmen, die den Preiswettbewerb ausschalten.
Praktische Compliance-Checkliste für Marken
Nachfolgend einige praxisorientierte, umsetzbare Schritte zur Risikominimierung in Bezug auf RPM-Vorwürfe:
-
-
Vertragsklauseln und Kommunikation prüfen. Identifizieren Sie vertragliche Klauseln oder informelle Anweisungen, die so aufgefasst werden könnten, dass sie die Fähigkeit von Händlern einschränken, Endpreise festzulegen (einschließlich „empfohlener“ Verkaufspreise, die jedoch faktisch verbindlich durchgesetzt werden). Formulierungen entfernen oder so ändern, dass Empfehlungen klar als unverbindlich ausgewiesen sind.
-
Überwachungspraktiken neu gestalten. Unterlassen Sie Monitoring, das mit Durchsetzungsdrohungen oder nachgelagerten Maßnahmen bei Preisabweichungen einhergeht. Ist Marktüberwachung aus Gründen wie Produktfälschungsschutz erforderlich, dokumentieren Sie sorgfältig, dass diese ausschließlich qualitäts- und imagebezogene Vorgaben überwacht und nicht der Preissteuerung dient.
-
Selektive Vertriebssysteme objektiv begründen. Wenn ein selektives Vertriebssystem eingesetzt wird, dokumentieren Sie die objektiven Auswahlkriterien. Stellen Sie sicher, dass die Kriterien objektiv, verhältnismäßig und nicht diskriminierend sind und sich auf qualitative Faktoren wie Ladenpräsentation, geschultes Personal oder Kundendienst nach dem Verkauf beziehen. Führen Sie eine belastbare Dokumentation zu der Notwendigkeit jedes Kriteriums zur Wahrung des Markenimages (unter Bezugnahme auf die Coty-Leitlinien).
-
Vertriebsteams schulen. Schulen Sie Markenmanager, Key-Account-Teams und Handelsbeziehungen so, dass sie die Grenze zwischen zulässigem Vertriebsmanagement und unzulässigen Preisbeschränkungen kennen. Mündliche Anweisungen an Händler können Beweiskraft haben.
-
Werberegeln überprüfen. Vermeiden Sie generelle Verbote von Rabattaktionen oder starre Zeitvorgaben, die im Ergebnis Verkaufszeiträume über unabhängige Händler hinweg uniformieren. Falls Werbekoordination erforderlich erscheint, gestalten Sie diese so, dass Händler Ermessensspielraum behalten.
-
Vorbereitung auf Durchsuchungen und Schutz von Privilegien. Entwickeln Sie ein belastbares Protokoll für unangekündigte Durchsuchungen und interne Untersuchungen, inklusive schneller Einschaltung von Rechtsbeistand, gesicherter Ablage und sorgfältiger Archivierung relevanter Kommunikation.
-
Frühzeitige Reaktion bei Compliance-Verstößen erwägen. Wird intern ein möglicher Verstoß erkannt, prüfen Sie die Vor- und Nachteile einer frühzeitigen Zusammenarbeit mit der Kommission im Rahmen des Kooperationsverfahrens (Anerkennung, Lieferung von Mehrwert-Beweismitteln). Die Kooperation kann zu erheblichen Bußgelderleichterungen führen, erfordert jedoch strategische Abwägungen.
-
Schlussfolgerung
Die Entscheidungen der Kommission gegen Gucci, Chloé und Loewe bestätigen bestehende Grundsätze des EU-Kartellrechts zur Wiederverkaufspreisbindung, ohne das Recht neu zu erfinden. Sie verbinden das dauerhafte Prinzip, dass Preissteuerung ein zentraler wettbewerbsbeschränkender Tatbestand ist, mit einem modernen Durchsetzungsansatz, der Paritätsregelungen für Online-Verkäufe, Rabattobergrenzen und Vorgaben zur Timing-Steuerung von Sonderverkäufen als ebenso problematisch ansieht, sofern sie der Preisautonomie der Händler den Boden entziehen.
Für Luxusmarken bleibt die Coty-Rechtsprechung eine enge Möglichkeit, das Markenimage über qualitative Vertriebsanforderungen zu schützen; Coty schützt jedoch nicht vor Verboten der Preissteuerung. Unternehmen im Luxussegment und darüber hinaus müssen daher ihre Preisstrategien, Überwachungspraktiken und vertraglichen Klauseln überprüfen und dokumentieren, dass Beschränkungen tatsächlich qualitativ, objektiv und verhältnismäßig sind und keinesfalls der Preisabstimmung dienen. Liegen frühere Praktiken im Grenzbereich, können frühe Korrekturen und gegebenenfalls strategische Nutzung des Kooperationsverfahrens die Sanktionsrisiken deutlich verringern.